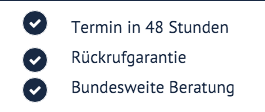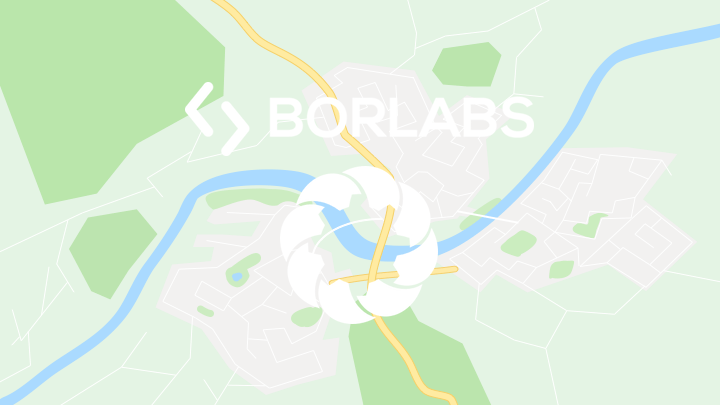Ihr Fachanwalt für Steuerrecht in Lübeck
– Rechtsanwalt Manuel Fuchs
– Rechtsanwalt Manuel Fuchs
Ihr Berater in Lübeck für Fragen in allen Bereichen des Steuerrechts sowie im Steuerstrafrecht.
Wir vertreten Sie und Ihr Unternehmen bundesweit in steuerrechtlichen Fragen sowohl gegenüber den Finanzämtern, Städten und Gemeinden, als auch vor allen Finanzgerichten.
Zu steuerrechtlichen Problemen kann es sehr schnell kommen. Das Finanzamt wertet einen Sachverhalt anders als Sie. Formalia werden nicht oder angeblich nicht eingehalten, Angaben gegenüber dem Finanzamt wurden vergessen, Fristen versäumt, eine Rechtsfrage falsch bewertet etc.
Häufiger Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit dem Finanzamt sind Außenprüfungen (Betriebsprüfungen, Umsatzsteuersonderprüfungen, Zollprüfungen, etc.). Dabei müssen solche Außenprüfungen noch nicht einmal ursprünglich Sie bzw. Ihr Unternehmen betreffen. Aber auch über Kontrollmitteilungen aus Außenprüfungen bei anderen Unternehmen können Sie und Ihr Unternehmen schnell in den Fokus des Finanzamtes geraten.
Die Ursachen für Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt sind also vielfältig.
Jede Steuerart sowie jeder Verfahrensschritt hat eigene Besonderheit und Anforderungen:
Einkommenssteuer (ESt), Solidaritätszuschlag (SolZ), Kirchensteuer (KiSt), Gewerbesteuer (GewSt), Umsatzsteuer (USt), Körperschaftsteuer (KSt), Erbschaftssteuer (ErbSt), Einspruchsverfahren, Klageverfahren, einstweiliger Rechtsschutz, Stundungsanträge, die Aussetzung der Vollziehung, etc. Wir stehen Ihnen zu jeder Zeit zur Seite
Dabei gilt stets: Je früher ein Problem erkannt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses zu Ihren Gunsten gelöst werden kann. Sollten Fragen entstehen, zögern Sie also nicht zu lange unsere Unterstützung einzuholen.
Auch und gerade für Startups ergeben sich viele steuerliche Fragen, die für den Unternehmenserfolg – insbesondere in den ersten drei Jahren – von Bedetung sind. Die Umsatzsteuer ist ein wichtiger Baustein, der durchdacht sein will. Eruiele ich überhaupt umsatzsteuerpflichtige Umsätze? Im Baugewerbe warten hier beispielsweise einige Besonderheiten („Reverse-Charge-Verfahren“, „Bauabzugsteuer“). Rechtzeitig aufgegriffen kann sie eine willkommene Liquiditätshilfe bieten. Unbeachtet dessen kann sie aber auch ein erfolgreich gestartetes Unternehmen in einen Liquiditätsengpass und sogar in die Insolvenz treiben. Mehr dazu lesen Sie unten unter StartUps.
Die Gewerbesteuer wird von den Städten und Gemeinden festgesetzt. Die Gewerbesteuer-bescheide der Städte und Gemeinde basieren aber auf den Gewerbesteuermessbescheiden, die von den Finanzämtern erlassen werden. Wollen Sie sich gegen die Grundlagen der Festsetzung wehren, ist es bei dem Erlass von Gewerbesteuerbescheiden der Städte und Gemeinden schon zu spät. Angegriffen werden müssen die Gewerbesteuermessbescheide. Lesen Sie dazu mehr unter Gewerbesteuer und Grundlagen- und Folgebescheid.
Nachfolgend haben wir für Sie zu einer Reihe häufig auftretenden Fragen einige Informationen zusammengestellt. Dies dient lediglich Ihrer Information und soll Ihnen helfen, eine steuerliche Frage besser einzuordnen. Eine Rechtsberatung im Einzelfall kann und soll dies nicht ersetzen.
Einspruch gegen Steuerbescheide:
Wenn Sie mit einer Steuerfestsetzung (Festsetzungsbescheid – Feststellungsbescheide) oder der Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nicht einverstanden sind, ist der Einspruch das Mittel Ihrer Wahl.
Gegen Steuerbescheid können Sie innerhalb einer Frist von einen Monat (nicht 4 Wochen) Einspruch einlegen. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe an Sie. Achtung: Bekanntgabe und Kenntnisnahme haben nichts mit einander zu tun (lesen Sie hier mehr zur Bekanntgabe von Steuerbescheiden).
Im Einspruchsverfahren können Sie Unrichtigkeiten in Steuerbescheiden korrigieren lassen.
Sollte die Monatsfrist für den Einspruch einmal schon abgelaufen seien, ist noch nicht zwingend alles verloren. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Steuerbescheide noch mehrere Jahre nach der Bekanntgabe änderbar. Dies kann der Fall sein, wenn der jeweilige Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht, er hinsichtlich bestimmter Teile vorläufig ist oder eine Änderungsnorm der Abgabenordnung greift. Dies kann nicht pauschal geschildert werden, sondern ist im Einzelfall zu prüfen.
Der Einspruch muss aber nicht nur innerhalb der Einspruchsfrist, sondern auch beim zuständigen Finanzamt und gegen den richtigen Bescheid eingelegt werden. Dies mag auf den ersten Blick einfach scheinen, was es im Regelfall auch ist, im Einzelfall kann dies aber auch kompliziert werden.
Am Ende des Einspruchsverfahrens steht entweder eine ablehnende Einspruchsentscheidung, eine stattgebende Einspruchsentscheidung (sog. Abhilfebescheid), eine teilweise ablehnende und teilweise stattgebende Einspruchsentscheidung oder auch eine tatsächliche Verständigung.
Wie es in den jeweiligen Fällen weitergeht, lesen Sie unter folgenden Links:
Im Fall einer ablehnenden oder teilweise ablehnenden Einspruchsentscheidung
Im Fall einer tatsächlichen Verständigung
Sollte für Sie das Verfahren nach dem Einspruchsverfahren enden, hoffentlich mit einer für Sie positiven Entscheidung, ist das Ergebnis steuerlich umzusetzen. Natürlich lassen wir Sie auch dabei nicht allein. Entweder verarbeiten wir die notwendige Änderung mit Ihrem Steuerberater oder vermitteln Ihnen einen kompetenten Steuerberater aus unserem Netzwerk, der Ihnen dabei zur Seite steht.
Festsetzungsbescheid – Feststellungsbescheid
Sie wundern sich vielleicht, dass im steuerlichen Zusammenhang manchmal von Festsetzungsbescheiden und manchmal von Feststellungsbescheiden die Rede ist. Kurz und grob gesagt, kann eine Steuerzahlung und eine Steuererstattung nur in einem Festsetzungsbescheid enthalten sein. In einem Feststellungsbescheid werden manchmal aber die Besteuerungsgrundlagen für eine spätere Festsetzung bestimmt bzw. festgestellt.
In manchen Fällen stehen Feststellungs- und Festsetzungsbescheid in einem Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheid (lesen Sie dazu mehr unter Grundlagen- und Folgebescheid).
Im Wesentlichen gelten für Festsetzungs- und Feststellungsbescheide aber dieselben Vorschriften. So können z. B. beide mit dem Einspruch angefochten werden.
Grundlagen- und Folgebescheid
Zu erkennen, welche Bescheid in einem Verhältnis von Grundlagenbescheid zu Folgebescheid stehen, ist extrem wichtig. Genauso schwierig und genauso wichtig ist es aber auch zu erkennen, welche Bescheide gerade nicht im Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheide zueinander stehen. In manchen Fällen impliziert der gesunde Menschenverstand nämlich, dass ein Verhältnis von Grundlagen- zu Folgebescheid gegeben ist. Das Steuerrecht sieht dies dann aber überraschend doch anders.
Ein klassisches Beispiel für Bescheide, die im Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheid stehen, sind der Gewerbesteuermessbescheid und der Gewerbesteuerbescheid. Die Besteuerungsgrundlagen werden im Gewerbesteuermessbescheid als Grundlagenbescheid festgestellt. Im Gewerbesteuerbescheid als Folgebescheid werden diese Grundlagen dann für die konkrete Steuerfestsetzung genutzt.
Bekanntgabe von Steuerbescheiden
Ein Steuerbescheid wird gegenüber demjenigen wirksam, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen ist. Die Wirksamkeit tritt im Zeitpunkt der Bekanntgabe ein. Bei Übersendung im Inland gilt ein Steuerbescheid am dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben. Bei Bekanntgabe im Ausland gilt er erst einen Monat nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben.
Geht der Bescheid tatsächlich erst später zu, gilt er im Zeitpunkt des tatsächlichen Zugangs als bekanntgegeben.
Im Fall der Bevollmächtigung eines Anwalts, Steuerberaters oder sonstigen Bevollmächtigten kann die Bekanntgabe auch an diesen erfolgen.
! Achtung: Wir stellen in der Praxis seit einiger Zeit fest, dass sich die Postlaufzeiten extrem verlängert haben. Nicht selten erleben wir Postsendungen die erst nach ein bis zwei Wochen, teils sogar noch später zugehen. Der Zeitpunkt des Zugangs sollte durch Sie als Empfänger bewiesen werden können, da die Rechtsprechung hier nicht zugunsten des Steuerpflichtigen ausfällt.
Gerichtverfahren/Klage
Sollten Sie Ihre Rechte einmal gegenüber dem Finanzamt im Einspruchsverfahren nicht oder nicht vollständig durchsetzen können, steht Ihnen der Weg zum Finanzgericht offen. Nicht jedes Rechtsmittel an das Finanzgericht ist eine Klage, aber wir beschäftigen uns an dieser Stelle zunächst nur mit dem Klageverfahren.
Es gilt zunächst die Klagefrist zu wahren. Sie beträgt einen Monat (nicht 4 Wochen). Auch wenn es einmal knapp wird mit der Einlegung der Klage, lohnt sich der Schritt dennoch, denn die reine Klageerhebung ist in der Regel kein großer Aufwand (Achtung! Ausnahmen bestätigen die Regel). Die Klagebegründung, die mit viel Arbeit verbunden sein kann, kann in einem gesonderten Schriftsatz nachgeholt werden.
Des Weiteren muss die Klage beim örtlich zuständigen Gericht erhoben werden.
Wer in ein steuerliches Klageverfahren geht sollte sich darüber im Klaren sein, dass sich dieses lange hinziehen kann. Die vorbereitenden Schriftsätze (Klage, Klageerwiderung, Replik, Duplik, etc.) sind auszutauschen und evtl. Beweismittel, wie z. B. Gutachten zu beschaffen. Nicht in jedem Fall findet eine mündliche Verhandlung statt. Wenn doch ist der erste Termin häufig ein sog. Erörterungstermin. Dort wird die Sach- und Rechtslage zunächst besprochen.
Unsere Erfahrungen vor den Finanzgerichten sind überwiegend positiv. Die Richterinnen und Richter sind hervorragend qualifiziert und setzen sich auch mit Komplizierten steuerlichen Fragen eingehend auseinander. Dabei sind sie vernünftigen Argumenten gegenüber offen. Es besteht also kein Grund den Gang zum Finanzgericht zu scheuen.
Für das finanzgerichtliche Verfahren fallen Gerichtskosten an. Deren Höhe richtet sich nach dem wirtschaftlichen Wert der Angelegenheit für Sie als Kläger. Der wirtschaftliche Wert ergibt sich oft aus dem Steuerbetrag, um den es geht. Im Fall des Obsiegens werden diese Kosten erstattet. Darüber hinaus kann allgemein über den Ablauf eines Klageverfahrens nicht viel gesagt werden. Jedes Klageverfahren ist anders und dementsprechend individuell zu betreiben. Wir besprechen mit Ihnen jeden einzelnen Schritt im Laufe eines solchen Verfahrens und entwickeln eine Strategie, die je nach Verlauf, Bedarf und Möglichkeiten angepasst wird.
Ähnlich dem Einspruchsverfahren kann auch das Klageverfahren auf verschiedene Arten enden:
Es kann ein stattgebendes oder ein ablehnendes Urteil oder auch ein teilweise stattgebendes und teilweise abweisendes Urteil ergehen. Darüber hinaus besteht oft auch die Möglichkeit, eine tatsächliche Verständigung zu treffen:
Gegen ein ablehnendes oder teilweise ablehnendes Urteil besteht die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Es kommt hier aber darauf an, wie genau das Finanzgericht entscheiden hat. Grundsätzlich kann die Revision eingelegt werden. Dies gilt so allerdings nur, wenn das Finanzgericht die Revision im Urteil zugelassen hat. Wurde die Revision nicht zugelassen, muss die Zulassung erst durch eine sog. „Nichtzulassungsbeschwerde“ erstritten werden.
Hier lesen Sie mehr über die Revision
Hier lesen Sie mehr über die Nichtzulassungsklage
Sollte das Verfahren aber doch nach dem finanzgerichtlichen Klageverfahren enden, hoffentlich weil der Klage vollumfänglich stattgeben wurde oder zumindest teilweise oder Sie eine tatsächliche Verständigung (Link zur tatsächlichen Verständigung) mit dem Finanzamt getroffen haben, lassen wir Sie nicht allein. Es gilt nun das Ergebnis des Klageverfahrens steuerlich umzusetzen. Natürlich stehen wir Ihnen auch dabei zur Seite.
Wenn Sie an dieser Stelle zu Ihrer Frage noch keine Hinweise gefunden haben, haben Sie bitte noch etwas Geduld. Wir bauen unser Angebot kontinuierlich aus. Zögern Sie aber auch nicht uns anzurufen. Auch in einem ersten Telefonat können wir manchmal schon weiterhelfen.
 Zusammen mit unserem Kooperationspartner „Das Steuerhaus“ erstellen wir für Sie natürlich auch Ihre Steuererklärung und den Jahresabschluss.
Zusammen mit unserem Kooperationspartner „Das Steuerhaus“ erstellen wir für Sie natürlich auch Ihre Steuererklärung und den Jahresabschluss.
Ihr Fachanwalt für
Steuerrecht in Lübeck